|
Erschienen im Hotel-Journal im Frühjahr 2000 Kinderfreundliche Hotels "Nur Mickeymouse-Schnitzel und Sirup genügen nicht!"
FABRICE MÜLLER Das Zimmer ist zum Spielen zu eng. Im Gang dürfen Marc und Sybille nicht herumrennen, weil es die anderen Gäste stört. Im Aufenthaltsraum wollen die Erwachsenen lesen. Und beim Abendessen ist wieder mal schlechte Stimmung angesagt, nur wegen dem verschütteten Sirup auf der weissen Tischdecke. Wie jedes Jahr in den Ferien. Kinder im Hotel – ein Alptraum für Eltern und Hotelier? Dies muss nicht sein. Ferien mit Kindern können für Eltern zu einem unvergesslichen Erlebnisund für Hoteliers einer vielversprechenden Marktlücke werden. Dies beweist der 1977 gegründete "Klub kinderfreundlicher Schweizer Hotels", dem heute rund 20 Betriebe angeschlossen sind. Kostenlose Betreuung Um Mitglied in Verein zu werden, müssen bestimmte Grundvoraussetzungen erfüllt werden. Gemäss Statuten verpflichten sich die Hotels zur kostenlosen Betreuung von Kindern ab 3 Jahren durch ausgebildetes Fachpersonal während mindestens fünf Tagen pro Woche und acht Stunden täglich, davon 24 Stunden pro Wochen im eigens dafür eingerichteten Spielzimmer. Eine Spielwiese mit Geräten muss vorhanden sein. Kindergerechte Ernähung, Essenszeiten und Einrichtungsgegenstände sowie eine Kochgelegenheit für Säuglingsnahrung sind weitere Statutenbedingungen. Betreuung ist nicht nur als Hüten zu verstehen, sie schliesst das Organisieren von Ferienerlebnissen und –abenteuern mit ein. Und doch ist jedes Hotel anders, jedes hat seine eigene Spezialität von Kinderfreundlichkeit. Der Entscheid war goldrichtig Alles begann eines Abends, als ein kleines Mädchen am Esstisch im Hotel Bellevue in Braunwald zu "täupeln" begann. Zu seiner Beruhigung versprach der Hotelier Martin Vogel, dem Kind eine Gute-Nacht-Geschichte nach dem Essen zu erzählen. Am folgenden Tag stellte das Mädchen die unweigerliche Frage: "Wenn ich wieder brav bin, erzählst Du mir dann noch eine Geschichte?" Nun hörten noch weitere Kinder dem Märchenonkel zu. Dieses Märchenstunde war der Ursprung des Klubs kinderfreundlicher Hotels. Vogel, der gebürtige Glarner aus alteingesessener Hotelierdynastie, macht beispielhaft vor, was ein ideenreicher Gastwirt mit einem 86 Jahre alten Haus fertigbringen kann. Der Entscheid, voll auf Kinder zu setzen, war goldrichtig: Auch in der Zwischensaison ist das "Bellevue" ausgebucht. Das Hotel hat sich geradezu zu einem Mekka für Kinder entwickelt. Hier stehen die Kinder nicht nur in der Hochglanz-Werbebroschüre im Mittelpunkt. Schon bei der Ankunft werden sie herzlich und speziell begrüsst. Sie erhalten einen eigenen Jeton für die Kinderbar, speisen in einem speziellen Saal, toben sich auf dem riesigen Luftschloss-Trampolin, dem Abenteuerspielplatz oder im Hallenbad mit Rutschbahn aus, und haben neben dem Märchenonkel eigenes Personal, das sich um ihr Wohlbefinden kümmert. Auch die kleinen Details, die den Kinderurlaub angenehmer gestalten, machen es aus, wie zum Beispiel kleinere Waschbecken und Kindertoiletten, eigene Geländer auf Kinderhöhe, oder eine Fundgrube, in der all das am Abend zusammengetragen wird, was die Kleinen so den Tag über verlegt haben. Die Erwachsenen kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Das Haus hat viele Ruhezonen, eine "Whisky-Apotheke" mit über 200 verschiedenen Sorten und stilvolle Salons. Und im Vogelschen Showblock greift die Ehefrau in die Tasten und der Märchenonkel begleitet auf der Handorgel. Das Märchenhotel verquickt einen Hauch von Zauberberg mit der fröhlichen Atmosphäre, die Kinder in ein Haus tragen. "Nur Mickeymouse-Schnitzel und Sirup genügen nicht, um die Anforderungen eines kinderfreundlichen Hotels zu erfüllen", betonen Lydia und Martin Vogel. "Ein solches Hotel kann nicht von einem Tag auf den andern entstehen. Es muss organisch wachsen." Ohne überdurchschnittliches Engagement, eine Dosis Show- und Animationstalent, nie enden wollende Ideen und natürlich Freude am Umgang mit Kindern wäre ein solches Projekt kaum erfolgreich. Vogel brachte mit seinen Ideen frischen Wind in die Hotellerie. Und er hat bewiesen: Wer auf Kinder setzt, hat Erfolg. Globi-Schloss in Disentis Dies durfte auch Ulrich Stümpfig von Disentiserhof in Disentis erfahren. Er eröffnete 1998 das Globi-Hotel im Schlösschen gleich neben dem Viersternhotel. Die Jahre zuvor sahen für den Disentiserhof nicht sehr rosig aus. Die Auslastungen liessen zu wünschen übrig. Als dann der 66. Globi-Band "Hotel Globi" im Globi-Verlag erschien, kam man auf die glorreiche Idee, Globi zur Leitfigur des Disentiserhofs zu machen. Für 1,2 Millionen Franken wurde das Schlösschen – welches dem früheren Direktorenehepaar als Wohnung und Büro gedient hatte – in ein Globi-Schloss umgewandelt. Das Gebäude wurde vollständig ausgeräumt und auf Globi getrimmt. Die Zimmer sind entweder rot-schwarz tapeziert, an anderen Wänden finden sich ganze Globi-Geschichten. Der Heizraum wurde in eine Räuberhöhle umgewandelt. Dann gibt es auch ein Globi-Museum, ein Lego-Zimmer, ein Märlizimmer, einen Theatersaal, usw. Im obersten Stock und in den Türmchen wurden 23 Schlafplätze eingerichtet. Im angrenzenden Garten stehen ein Tippi und ein Ritterzelt. Zusammen mit Sponsoren wie Lego, Musikhaus Jecklin, Polaroid, den Bergbahnen Disentis und anderen konnten Stümpfig das Schlössli in ein Kinderparadies umwandeln. "Wir rechneten mit einem Zuwachs von höchstens 12 Prozent – eine Zahl, die bei weitem übertroffen wurde. Doch wir sind noch lange nicht fertig..." Ferien mit – nicht von Kindern machen Vom Feuer der Kinderhoteliers angesteckt, wagten das Ehepaar Kalbermatten vom Hotel Edelweiss in Blatten (Lötschental) den Schritt in Richtung Kinderhotel und traten dem Verein bei. Der Aufenthaltsraum wurde zum Spielzimmer umfunktioniert; direkt beim Haus erstellt die Gemeinde einen grosszügigen Kinderspielplatz; die Speisekarte wurde angepasst, und bei der Renovation der Badezimmer wird an die Bedürfnisse der Kinder gedacht; die Doppelzimmer werden mit direkten Türen verbunden. "Familien mit einen kleineren Ferienbudget sollen bei uns ebenso willkommen sein wie finanzkräftigere Familien. Unsere Kinderbetreuung zielt darauf ab, dass die Eltern Ferien mit Kindern und nicht von den Kindern machen. Wir bieten pro Woche zwei Halbtagesprogramme für die ganze Familie. Ausserdem werden wir nun auch die Hebel in der Region ansetzen müssen, sollte doch auch ausserhalb des Hauses ein gewisses Familienprogramm vorhanden sein." Informationen: Klub kinderfreundlicher Schweizer Hotels, 8784 Braunwald. Tel. 055 643 38 44, Internet: Fehler! Textmarke nicht definiert.
1 Comment
Erschienen in der Neuen Zürcher Zeitung am 8. April 2000 Menschen, die das Gespräch mit Kriminellen suchen. |
AutorFabrice Müller Archiv
April 2019
Kategorien
Alle
|
|
journalistenbuero.ch GmbH
Fabrice Müller Breitenloh 6 CH-4332 Stein AG Tel. 0041 (0)62 873 34 54 Fax 0041 (0)62 873 54 73 info@journalistenbuero.ch |
layout & design by: success4less - Erfolg für jedes Budget.
|

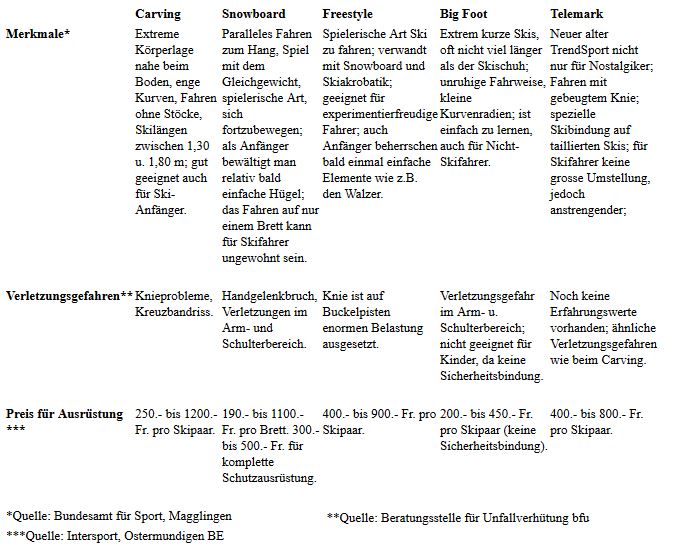
 RSS-Feed
RSS-Feed
